GENDERN
*_/IN
Gendern oder nicht? Die Schlacht um das generische Maskulinum tobt auch in Unternehmen. Beide Seiten haben gute Argumente
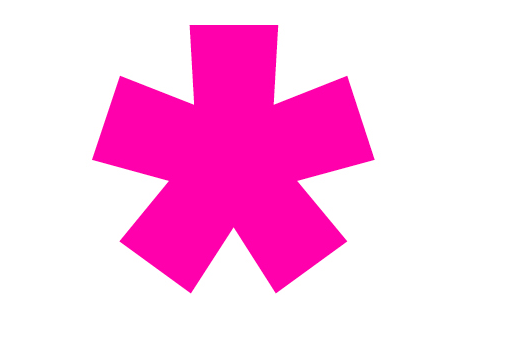
CONTRA
Setzt sich das Gendering durch, gibt es bald keine Mitarbeitermagazine und Kundenzeitschriften mehr. Auch Patientenbroschüren, Ostfriesenwitze und Lehrerzimmer werden aussterben. Branchenmedien wie „Journalist“ oder „Pressesprecher“ werden aufhören zu existieren. Der „Kicker“ natürlich auch.
„Was für ein Quatsch!“ werden die Verfechter*innen der geschlechtergerechten Sprache nun sagen. „Mitarbeitermagazine bleiben doch in der Sache bestehen, auch wenn sie künftig Beschäftigtenmagazine heißen.“ Es gibt doch einen Unterschied zwischen Begriff und Gegenstand. Und damit hätten sie sogar recht.
Das Problem ist nur: Genau diesen Unterschied zwischen Symbol und Sache, zwischen Bezeichnendem und Bezeichnetem negieren die Sachwalter*innen des Gendering ständig. Sie machen das grammatische Geschlecht abhängig vom biologischen, so als ob beide ein und dasselbe wären. Dabei sind Staubsauger oder Drucker nicht deswegen männlich, weil Staubsaugen und Drucken rein männliche Tätigkeiten wären. Sondern schlicht deshalb, weil im Deutschen viele Substantive gebildet werden, indem man Verben die Endung „er“ anhängt. Das betrifft nicht nur menschliche Mitarbeiter, sondern auch Locher, Bohrer und Entsafter.
Im Türkischen gibt es kein Genus
Natürlich beeinflusst die Sprache das Denken. Aber wie stark Grammatik an dieser Prägung beteiligt ist, lässt sich nicht leicht beziffern. Das Türkische etwa kennt weder Genus noch Anapher (er, sie, es). In türkischsprachigen Medien gibt es also nichts zu gendern. Trotzdem ist fraglich, ob sie schon deswegen der Gleichberechtigung der Geschlechter besser das Wort reden.
Partizipien und Passivkonstruktionen, Unterstriche, Sternchen und Doppelnennungen machen Texte hässlich, langsam und unverständlich. Warum sollte man – um einer rein grammatischen Gerechtigkeit willen – solche Nebenwirkungen in Kauf nehmen? Wer ändern will, dass Frauen in vielen Unternehmen immer noch schlechter bezahlt und langsamer befördert werden als Männer, der sollte an der Sache ansetzen. Und nicht bei den Worten.
PRO
„Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt“, schrieb der Sprachphilosoph Ludwig Wittgenstein schon 1918 – da lag die Genderdebatte noch in ferner Zukunft. Und doch trifft das Zitat den Nerv der Diskussion. Denn die Grenzen der Sprache zwingen wir uns selbst auf, wenn wir patriarchalen Strukturen noch immer folgen und in der Sprache das Männliche in den Fokus stellen.
Die Genderdebatte hat diesen Problemfall längst verstanden. Lässt man in der Sprache die Frau außen vor, bleibt das nicht ohne Folgen. Schließlich dient Sprache nicht bloß als Hülle, die keinen Einfluss auf das Gedachte hat – sie bestimmt unser gesamtes Denken und damit unsere Realität entscheidend mit. Die Grenzen und Freiheiten unserer Lebenswirklichkeit gründen auf ihrem Reichtum. Das zählt im alltäglichen ebenso wie im handwerklichen Gebrauch, ob nun im Journalismus oder der Unternehmenskommunikation.
Und zu dieser Welt gehören, auch wenn einigen das nicht zu schmecken scheint, ebenso gleichberechtigte Frauen, Inter- und Transsexuelle oder, um es kurz zu fassen, alle Menschen, die ein anderes Geschlecht als das männliche haben. Diese Einsicht steht im Hintergrund, wenn die Genderdebatte die Frage thematisiert, ob und wie neben den Männern auch Frauen und Andersgeschlechtliche gleichberechtigt in der Sprache Platz finden können.
Bequemlichkeit ist keine Ausrede
Ohne Frage: Verständlichkeit, Anwendbarkeit und Transparenz sind Eckpfeiler einer gelungenen und funktionierenden Sprachpraxis. Allerdings nur so lange, wie Sprache nicht als Propagandamittel missbraucht wird. Beginnt sie aber, durch das generische Maskulinum zu diskriminieren und Frauen auf der Vorstellungsebene in den Hintergrund zu drängen, ist die gängige Praxis kritisch zu hinterfragen. Bequemlichkeit und die fehlende Bereitschaft, neue Entwicklungen der Sprache mitzugehen, reichen jedenfalls nicht für eine rationale Begründung aus. Damit lässt sich das Gendern nicht einfach als Unsinn abtun.
Ob Binnen-I (StudentInnen), Splitting (Student/Innen), Gender Gap (Student_Innen) oder Asterisk (Student*Innen): Es gibt viele Varianten, um die Gleichberechtigung der Geschlechter in der Sprache zu erreichen. Aber auch für diese einfachen Formen des Genderns sind die Bereitschaft und der Wille zu Veränderungen notwendig. Der Sprachwandel der letzten Jahrhunderte hat eindrücklich gezeigt, dass wir uns kommunikativ weiterentwickeln können. Vieles spricht dafür, dass das Gendern die Grenzen unseres Denkens ausweiten kann – und damit auch die Grenzen unserer Welt.